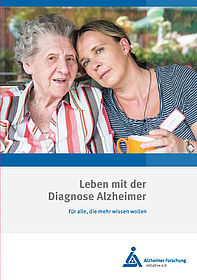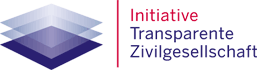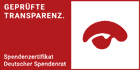Behandlung der Alzheimer-Demenz
Die Alzheimer-Krankheit kann bisher nicht geheilt werden. Eine Behandlung kann jedoch die Symptome der Alzheimer-Krankheit und die damit verbundenen Beschwerden lindern und die Lebensqualität der Erkrankten verbessern. Medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien werden kombiniert eingesetzt.
In der Alzheimer-Therapie können Medikamente wie Antidementiva und Antidepressiva eingesetzt werden. Sie können vor allem im frühen und mittleren Stadium helfen, die Gedächtnisleistung möglichst lange zu erhalten und Begleiterscheinungen zu mildern. Aber auch nicht-medikamentöse Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel die Musik- oder Ergotherapie, sind bei der Alzheimer-Krankheit inzwischen anerkannt. Ziel ist es, die Stimmung der Betroffenen zu verbessern, ihre Fähigkeiten zu erhalten und ihnen zu helfen, im Alltag besser mit der Krankheit zurechtzukommen.
Nur eine Ärztin oder ein Arzt kann auf der Grundlage einer genauen Diagnose über die richtige Behandlung entscheiden. Da sich die Beschwerden im Verlauf der Erkrankung verschlimmern, ist es wichtig, so früh wie möglich mit einer Therapie zu beginnen. Suchen Sie daher bei den ersten Anzeichen einer Alzheimer-Demenz frühzeitig eine Ärztin oder einen Arzt auf. Ziel der Behandlung ist es, den Betroffenen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Neues Medikament in den USA
Berechtigten Grund zur Hoffnung für Alzheimer-Patienten und Patientinnen im frühen Stadium bietet der Wirkstoff Lecanemab, der Anfang 2023 unter dem Handelsnamen „Leqembi“ in den USA zugelassen wurde. Für Europa wird eine Zulassung derzeit geprüft. Mehr Infos zu Wirkstoffen und Therapieansätzen finden Sie hier.
Lesen Sie dazu auch das Interview mit Prof. Ralf Ihl, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie und -therapie am Alexianer-Krankenhaus Krefeld. Er beantwortet Fragen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Alzheimer-Behandlung und was man beachten sollte.
Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber
Weitere Informationen zum Thema
Medikamentöse Behandlung
Gedächtnisverlust verzögern und Depressionen lindern
Nicht-medikamentöse Behandlung

Selbstständigkeit erhalten und Wohlbefinden fördern
Verlauf einer Alzheimer-Erkrankung

Welche Symptome sind typisch für die vier Stadien?