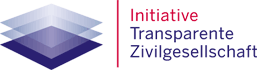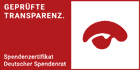Wie trägt das Protein Tau zum Funktionsverlust von Nervenzellen bei?
Projektdetails:
| Thematik: | Ursachenforschung |
|---|---|
| Förderstatus: | laufend |
| Art der Förderung: | Research |
| Institution: | Uniklinik Köln, Funktionelle Genetik der Neurodegeneration und neurologische Erkrankungen |
| Projektleitung: | Dr. Dr. Hans Zempel |
| Laufzeit: | 01. Januar 2023 - 31. Dezember 2025 |
| Fördersumme: | 150.000,00 Euro |

Was wird erforscht?
Das Protein Tau ist in Nervenzellen überwiegend in Nervenzellfortsätzen in den Mikrotubuli zu finden. Mikrotubuli sind Röhrenstrukturen, die das Zellskelett stabilisieren. Bei der Alzheimer-Krankheit kommt es zu einer Fehlverteilung und Verklumpung des Tau-Proteins. In vorangegangenen Experimenten konnte gezeigt werden, dass diese Fehlverteilung zu einem Verlust von Mikrotubuli und somit zu einem Funktionsverlust der Nervenzellen führt. Es wurden bereits Enzyme identifiziert, die an diesen Prozessen beteiligt sind und die Mikrotubuli und somit auch das Zellskelett zerstören. Die Veränderungen des Tau-Proteins passen zwar zum klinischen Verlauf der Alzheimer-Krankheit, dennoch ist noch nicht klar, wie Tau zum Funktionsverlust der Nervenzelle führt. Dr. Dr. Hans Zempel von der Uniklinik Köln wird die gefundenen Enzyme genauer untersuchen und der Frage nachgehen, wie die Fehlverteilung von Tau zum Funktionsverlust der Nervenzellen beiträgt.
Wie geht Dr. Dr. Zempel dabei vor?
Das Forschungsteam um Dr. Dr. Zempel verwendet menschliche Nervenzellen für die Experimente, die aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) hervorgegangen sind. Es werden die Enzyme identifiziert, die maßgeblich für den Verlust der Mikrotubuli verantwortlich sind. Mittels Fluoreszenz-Mikroskopie werden die Tau-Proteine sichtbar gemacht. Außerdem wird untersucht, welche Enzyme sich als therapeutisches Ziel anbieten.
Was ist das Ziel des Forschungsprojekts?
Das Projekt soll dazu beitragen die molekularen Vorgänge der Tau-Fehlverteilung aufzuklären. Dieses Wissen kann neue Therapieoptionen für die Alzheimer-Krankheit und andere Krankheiten ermöglichen, bei denen das Tau-Protein eine krankheitsrelevante Rolle spielt.
Wofür werden die Fördermittel verwendet?
Die Fördermittel entfallen auf Gehälter (108.000 Euro), Labormaterialien (34.500 Euro), Dienstleistungen wie Mikroskopie-Arbeiten (5.400 Euro), Reisemittel für wissenschaftliche Kongresse (1.100 Euro) und Publikationskosten (1.000 Euro).
Das Projekt wird freundlicherweise von der Wilhelm-Emanuel-Zach-Stiftung unterstützt.
Sehen Sie sich die Videobotschaft von Dr. Dr. Zempel an.
Steckbrief:
Dr. Dr. Hans Zempel
1982
2008
Nürnberg
2 Kinder, in Partnerschaft
Hobbys:
Sprachen, Musik

Ich bin Alzheimer-Forscher, weil...
die Alzheimer-Erkrankung eine unvorstellbare Belastung für die Patient*innen und Angehörigen ist, und ich hoffe einen substanziellen Beitrag für eine echte Therapie leisten zu können.
Mein Forschungsprojekt ist besonders aussichtsreich, weil...
es auf einen schon teilweise aufgeklärten molekularen Mechanismus basiert, der eine echte Erklärung für die Krankheitsursächlichkeit des sog. Tau Proteins darstellt (nämlich der Tau-basierte Verlust von Zellskelettstrukturen), und das Projekt nicht nur neue Aspekte dieses Mechanismus aufzeigen wird, sondern auch in einen translatierbaren Ansatz münden könnte.
Ich hoffe, dass die Alzheimer-Forschung in 10 Jahren...
für alle genetischen und einen Großteil der sporadischen Alzheimer Fälle echte Therapieoptionen hervorgebracht haben wird.
Persönliche Nachricht:
Sehr geehrte Spender*innen,
Ihr Beitrag, der nun über die AFI zu einem substantiellen Beitrag zur Erforschung der Alzheimer-Erkrankung geworden ist, ist eine der wenigen Möglichkeiten für die akademischen Forschungsinstitute sinnvolle biomedizinisch-relevante Forschung zu finanzieren. Wir identifizieren und erforschen grundlegende Krankheitsmechanismen der Alzheimer-Erkrankung. Nur die akademische Forschung stellt ihre Ergebnisse allen Forschern und auch pharmazeutischen Entwicklern zur freien Verfügung. Durch jedes Forschungsprojekt wird also neues Wissen generiert, was durch andere Forschende und auch Therapieentwickler aufgegriffen wird, wodurch letztendlich erst ein wirkliches molekulares Verständnis der Alzheimer-Erkrankung entstehen kann. Dies wiederum ist die Basis für eine zielgerichtete Entwicklung von echten Therapiemöglichkeiten.